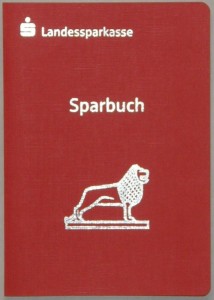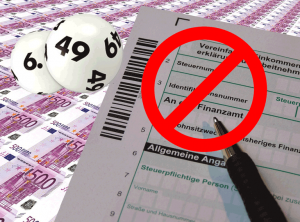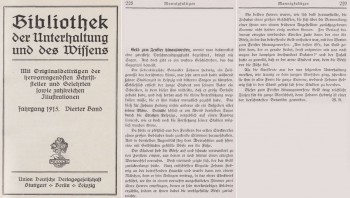Ultrareich – dieser Begriff ist mir vor wenigen Tagen über den Weg gelaufen. In einer Studie der Schweizer Bank UBS und der Beratungsfirma Wealth-X bin ich zum ersten Mal auf diesen Begriff gestoßen. Dort wird ultrareich wie folgt definiert:
Ultrareich ist, wer über ein Vermögen von mehr als 30 Millionen Dollar verfügt
Wer bisher das bescheidene Ziel hatte lediglich ein gewöhnlicher Millionär zu werden, der muss schon noch einiges draufpacken, um jemals in diesen elitären Kreis zu gelangen. In dieser Studie stecken einige interessante Zahlen und Fakten.

Insgesamt besitzen die Ultrareichen inzwischen fast 30 Billionen Dollar, das entspricht momentan ca. 24 Billionen Euro. Damit kontrollieren sie 13 Prozent des gesamten Vermögens der Welt. Dieser Anteil des Weltvermögens ist in den Händen von nur 0,004 Prozent der Erwachsenen. Somit gelten derzeit weltweit 211.275 Menschen als ultrareich.
Dass die reichsten Menschen der Welt immer reicher werden, ist auch ein Ergebnis dieser Studie, was aber nicht zu verwundern braucht, denn diese Tendenz hält schon seit einigen Jahren an. Wealth-X ermittelte unter den Ultrareichen 2325 Milliardäre, also Menschen, die über ein Vermögen von mehr als einer Milliarde US-Dollar verfügen. Milliardäre werden oft als superreich bezeichnet.
Die Zahl der Milliardäre stieg im Vergleich zum letzten Jahr um 6%, das Gesamtvermögen der Supereichen erhöhte sich aber um 7%.
Die Vermögensanalysten der einzelnen Institutionen scheinen aber bei der Berechnung der Vermögensverhältnisse der Milliardärskandidaten sehr unterschiedliche Maßstäbe anzulegen. Forbes z.B. zählte für 2014 „nur“ 1645 Milliardäre. Da liegt die Studie von USB / Wealth-X mit 2325 Milliardären deutlich drüber. In meiner überarbeiteten Forbes Liste 2013 habe ich die 1426 Milliardäre des letzten Jahres alle einzeln mit diversen Zusatzinformationen aufgelistet. Die Liste kann individuell gefiltert und sortiert werden, wenn man einzelne Milliardäre genauer unter die Lupe nehmen will.
Noch mehr Ultrareich-Statistik …
Laut Wealth-X-Studie entfällt von den 30 Billionen Dollar rund ein Drittel auf Ultrareiche in den USA, über ein Viertel auf Europa und ca. 23 % auf ultrareiche Asiaten.
68 % aller Ultrareichen gehören in die Kategorie „Selfmade“, denn sie sind nach eigenen Angaben selbst zu ihrem Vermögen gelangt, 13 % haben ihr Vermögen geerbt. Der Rest hat seinen Wohlstand sowohl geerbt als auch selbst erwirtschaftet.
87 % der Ultrareichen waren Männer. Die Männer kamen auf ein Durchschnittsalter von 59 Jahren, die Frauen waren im Schnitt 57 Jahre alt. Bei den Frauen hatte fast die Hälfte ihr Vermögen geerbt.
Quelle
Wer will, kann sich die vollständige Studie von www.worldultrawealthreport.com herunterladen – allerdings muss man sich dort vorher registrieren.